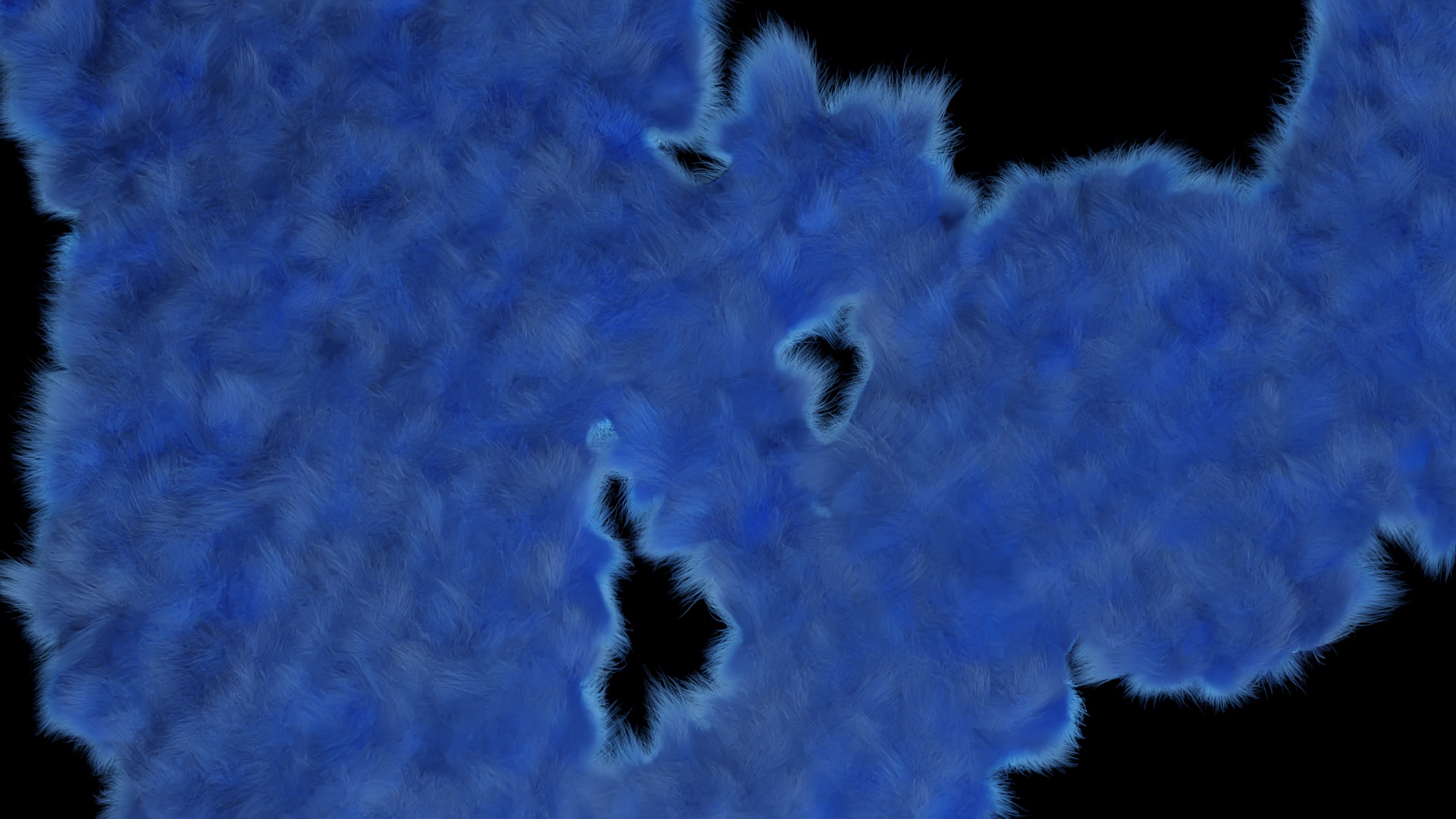
Schriftgröße anpassen
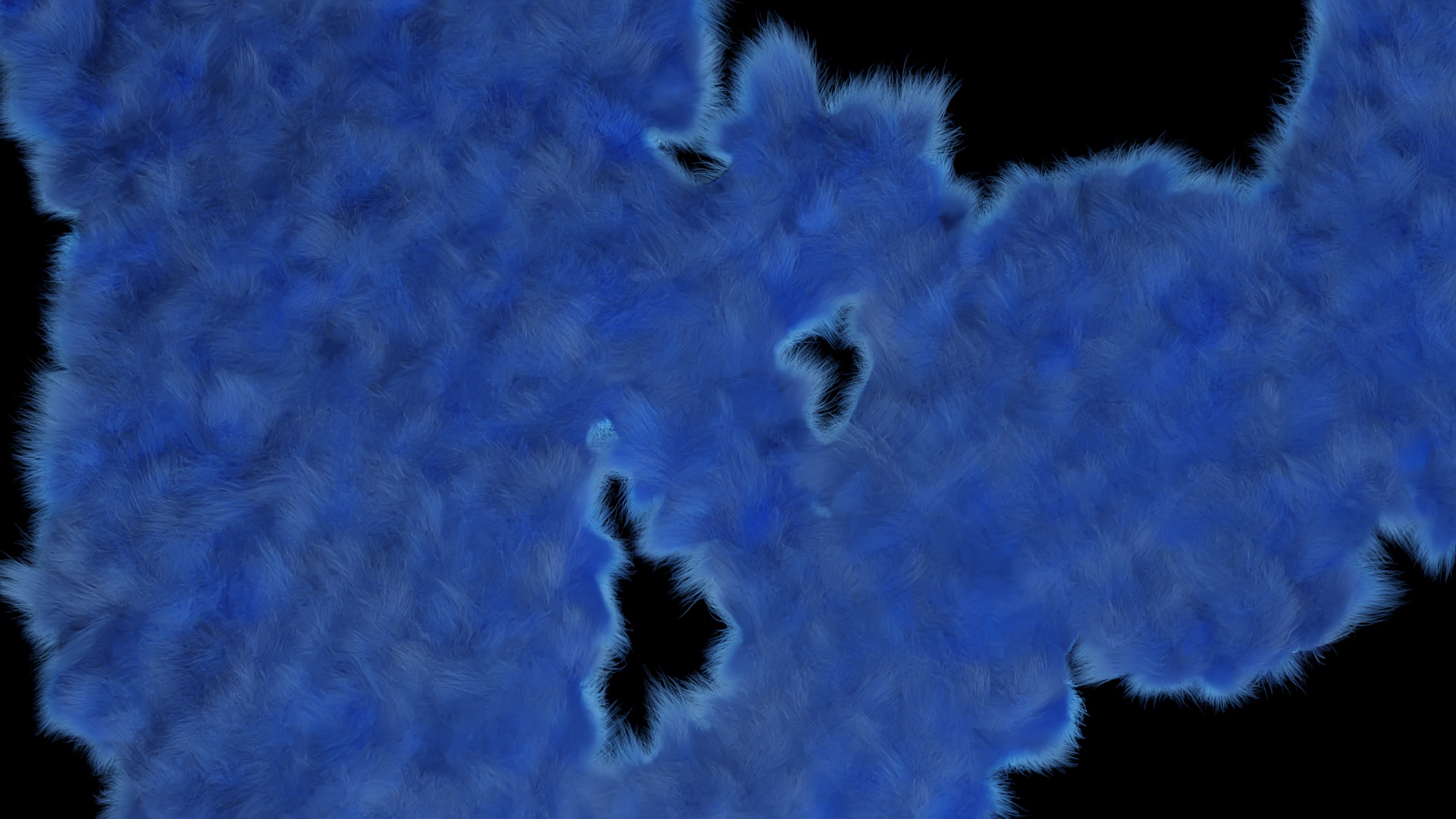
Konfliktdynamiken in den LGBTQIA+-Communitys
Vera Hofmann:
Lieb* Gisela Fux Wolf, danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Du bist Psychotherapeut*in in einer Berliner Gemeinschaftspraxis.Einleitend möchte ich nach deiner Einschätzung fragen: Wo stehen die Berliner und die deutschen LGBTQIA+-Communitys und ihre Konflikte heute im Gegensatz zu früher? War in den 1980ern/90ern alles rabiater, wie mir oft, die heutige Zeit beschwichtigend, erklärt wird?
Gisela Fux Wolf:
Ich bin erst seit 2011 in Berlin, habe aber viel über die hiesige Bewegungsgeschichte gelesen und mich auch mit Aktivist*innen ausgetauscht. Den größten Teil meiner queeren Sozialisation habe ich allerdings in einer kleinen und sehr eng vernetzten queeren Community in Freiburg erlebt. Ich habe den Eindruck, dass sich die Community-Konflikte in ihren grundlegenden Dynamiken und auch in ihrer Schärfe gar nicht so groß verändert haben. Bloß die Inhalte unterscheiden sich und wer adressiert wird ist anders. Zum Beispiel glaube ich, dass sich früher, in den 1980er und 1990er Jahren starke Persönlichkeiten aus der schwulen und lesbischen Community sehr mit der umgebenden heterozentristischen Gesamtgesellschaft gerieben haben. Diese haben in ihrer aktivistischen Arbeit sehr viel riskiert. Auch einzelne und sehr mutige trans* Persönlichkeiten waren damals schon sichtbar. Es gab neben den solidarischen Kämpfen gegen die Auswirkungen des Heteropatriarchats jedoch immer auch Bruchlinien zwischen Lesben und Schwulen. Auch innerhalb der Schwulenbewegung gab es Brüche. Zum Beispiel zwischen Schwulen, die eher sehr mainstreamig und mit entsprechender Männerrolle aufgetreten sind, und tuntigen Schwulen oder Schwulen mit eher gendernonkonformem Auftreten. Aus der Schwulenbewegung kenne ich auch massive Konflikte zwischen gewaltbetroffenen Schwulen und schwulen Männern, die diese Erfahrungen nicht machen mussten. Es gab weiter auch in der schwulen und lesbischen Bewegung massive Auseinandersetzungen um Offen- und Verstecktleben, Anpassung oder Nichtanpassung. Verstecktlebende Lesben und Schwule wurden in den Communitys manches Mal verächtlich gemacht, ohne zu bedenken, dass die Möglichkeiten, offen zu leben, durchaus nicht für alle gleich waren. Und es gab leider auch in eher anpassungsorientierten schwulen und lesbischen Gruppen Abgrenzungen von Menschen, die als besonders konfliktprovozierend im Umgang mit der Hetero-Gesellschaft betrachtet worden sind. Also zum Beispiel eine Abgrenzung gegen schwule Tunten, die sich für die HIV/Aids-Bewegung stark gemacht haben – da kann ein schwuler Aktivist sicherlich viel mehr sagen – oder auch die Feindseligkeit von cis Lesben gegenüber lesbischen trans* Frauen. Hier haben wir aktuell nach meinem Eindruck einen backlash: Wenn wir die Geschichte der Lesbenfrühlingstreffen betrachten, dann gab es Ende der 1990er Jahre mal eine Zeit, in der durch massive Aufklärungsarbeit von engagierten trans* Frauen und solidarischem Engagement von cis Lesben eine Offenheit geschaffen wurde, die nun durch trans*feindliche Veranstaltungen auf den letzten LesbenFrühlingsTreffen wieder konterkariert wird.
Es gab und gibt in queeren Kontexten auch immer wieder Entwertungs- und Ausschlusspraktiken gegen HIV-positive und auch gegen psychisch kranke Menschen. Schließlich gab es zwischen Schwulen und Lesben und auch innerhalb schwuler Communitys massive Auseinandersetzung um Pädo-Sexualität. Ich habe noch mitbekommen, wie diese Thematik sowohl schwule Gruppen intern zerhauen hat, als auch in zahlreichen Städten in Deutschland zu einer massiven Spaltung zwischen der lesbischen und der Schwulenbewegung geführt hat. Ich hatte mein Coming Out Mitte der 1990er und habe relativ schnell die Konflikte um Pädo-Sexualität mitbekommen. Hier bin ich im Übrigen der Unterstützung der Aufarbeitung dieses Feldes durch das Schwule Museum sehr dankbar[1].
Insgesamt würde ich nicht sagen, dass die Konflikte schlimmer geworden sind oder dass die Konflikte früher schlimmer waren und jetzt weniger schlimm sind, sondern die Konfliktthemen haben sich verschoben. Und es gibt nicht mehr so die krasse Spaltung zwischen der Mainstream-Gesellschaft und der queeren Bewegung, sondern es gibt queere Menschen, die sich gar nicht der Mainstream Gesellschaft unterwerfen und auch nicht reinpassen wollen, und viele queere Menschen, die sehr gerne reinpassen möchten. Ich würde sagen: die Bruchlinien innerhalb queerer Communitys in Deutschland sind vielfältiger geworden. Und die Mainstream-Gesellschaft lockt natürlich auch mit Anerkennungsversprechungen und Privilegien.
VH:
Du würdest also sagen, dass die Debatten um Subjektpositionierungen heute das Hauptkonfliktfeld sind?
GFW:
Ich glaube, je vielfältiger die Identitäten werden und je mehr sich die Szene ausdifferenziert, desto mehr ringt sie um das Thema Gruppenzugehörigkeit an unterschiedlichen Konfliktlinien. Während es früher zwischen Schwulen und Lesben viel um Sexismus und Gewalt im Geschlechterverhältnis ging, geht es heute ja auch deutlicher um z.B. Rassismus, Klassismus und Ableismus. Diese Themen wurden auch schon in den 1990er Jahren und davor von Aktivist*innen (wie Audre Lorde, Ulrike Janz, Kassandra Ruhm und weiteren) angesprochen, erreichten jedoch nicht die Resonanz, die sie heute haben. Heute erlebe ich es so, dass Rassismus viel stärker diskursiviert wird als Klassismus und Ableismus. Beim Thema Ausgrenzung von Menschen aufgrund von Erkrankungen oder Behinderungserfahrungen haben sich die Diskurse deutlich gewandelt. Wir hatten auch mal Debatten in der queeren Community, bei denen über die Ausgrenzung von kranken Menschen in der Gesellschaft sehr viel stärker kritisch diskutiert worden ist – mit dem Ziel der Solidarisierung gegen diese Ausgrenzung. Das war im Zusammenhang mit HIV und AIDS. Die Diskussion wurde damals sehr stark von Aktivist*innen, u.a. aus den AIDS-Hilfen, vorangetrieben und hat so schließlich auch die Gesamtgesellschaft erreicht. Ich erlebe es jetzt so, dass der Diskurs um Feindseligkeit gegen Personen, die erkrankt sind und/oder behindert werden, inhaltlich breiter geworden ist: wir diskutieren in den Communitys unterdessen auch über Ausgrenzung von psychisch kranken queeren Menschen und es gibt auch hier sehr engagierten Aktivismus, um diese Ausgrenzung zu überwinden. Und Sexismus ist ja leider ein Dauerkonfliktthema.
VH:
Warum ist das Miteinander in den Communitys so konfliktreich?
GFW:
Konflikte in Communitys sind notwendig und wichtig. Allerdings werden Community-Konflikte manchmal auf Arten ausgetragen, die sehr viele Verletzungen produzieren. Das ist bitter, denn gerade wenn wir massive Konflikte mit Personen haben, von denen wir in einer hetero-und cissexistischen Gesellschaft Rückhalt brauchen, können uns diese Konflikte sehr nah gehen. Ich habe in einigen Konflikten mitten drin gesteckt, versuche, daraus zu lernen. Auch heute bricht es mir das Herz, wenn ich sehe, wie verletzend queere Menschen manchmal miteinander umgehen. Das treibt mich um.
Aktivist*innen, die sich mit Community-Konflikten sehr intensiv beschäftigt haben, haben darauf aufmerksam gemacht, dass Konflikte in marginalisierten Communitys mit dem Leid verbunden sind, welches durch Marginalisierung entsteht[2]. Die Gewalt und die Diskriminierungen, die wir im Rahmen des gesamtgesellschaftlichen Kontextes erleben, schaffen einen Druck, der letztlich auch zu massiven Projektionen führen kann, die dann Konfliktdynamiken verschärfen. Auf der Basis dieses Drucks werden dann manches Mal in Community-Konflikten Verletzungen zugefügt. Auch dann, wenn die andere Seite eigentlich gar nicht mal so stark unterschiedliche Meinungen hat und durchaus in der Lage wäre, zuzuhören und sich zu bewegen.
Ich schließe mich dem an, was Sarah Schulman für US-amerikanische queere Communitys herausgearbeitet hat: Marginalisierte Communitys und so auch queere Communitys im Speziellen weisen manches Mal Konfliktdynamiken auf, die eigentlich von außen kommen, aber intern ausgetragen werden. Nahestehende Personen in den Communitys, Freund*innen, Partner*innen werden dann in Konfliktdynamiken verstrickt, die durch die Gewalt aus der Mehrheitsgesellschaft wesentlich mitbedingt sind. Und leider haben wir die Tendenz, Konflikte insbesondere an nahestehenden Personen abzuarbeiten, weil wir es nicht wagen, diejenigen zu konfrontieren, die uns die Gewalt tatsächlich angetan haben.
VH:
Schulman spricht ja auch vom Phänomen der Verschiebung von Täter*innenschaft und wie Folgschaft durch Propaganda hergestellt wird. Und du hast es eben angedeutet: diejenigen, die sich heraustrauen, die für gewisse Rechte kämpfen, die sich gegen die Mehrheitsmeinung zur Wehr setzen, werden plötzlich zur Feind*in der Community erklärt, von ihr bedroht, weil versucht wird, die Community nach innen zu schützen. So werden diese Leute isoliert. Wie lässt sich das psychologisch erklären?
GFW:
Schulman beruft sich auf eine psychoanalytische Diskurs-Tradition um New York herum. Dorthin sind viele psychoanalytische Kolleg*innen emigriert; viele, um vor den Nazis zu fliehen. Ich bin selber nicht psychoanalytisch ausgebildet. Ich finde aber Beobachtungen und Schlüsse von Schulman sehr spannend und hilfreich, um Community-Konflikte zu verstehen. Sarah Schulman referiert auf eine Form von Psychoanalyse, die, um den Betroffenen von Gewalt eine Stimme zu geben, sehr viel Wert legt auf ein offenes Aussprechen von Missständen und ein Durchdringen von Gewaltdynamiken. Ich finde, dass diese Art des psychoanalytischen Denkens zum Verständnis von Community-Konflikten sehr viel beitragen kann. Die Dynamiken um Gewalt beinhalten Mechanismen wie, dass, um jemandem Gewalt antun zu können, zunächst das Bild von der Person ins Negative verzerrt werden muss. Es wird projiziert. Es gibt einen eigenen inneren Konflikt, der nicht gut erkannt wird, der vielleicht mit Scham besetzt ist, und der dann auf andere projiziert und an denen sich abgearbeitet wird. Das Gegenüber stellt dann für die projizierende Person eine Leinwand für ihre inneren Konflikte dar. Das ist also ein mehrschrittiger Prozess. Mit der Negativ-Projektion legitimiert dann die Person den Angriff. Sie fühlt sich berechtigt, mit der anderen Person nicht gut umzugehen. Diese spezifische und durch Privilegien geprägte Wahrnehmung, das Recht zu haben, andere anzugreifen, bezeichnet Schulman mit dem Begriff supremacy, also einem Komplex aus Überlegenheits- und Rechtfertigungsempfindungen, der durch zahlreiche innere Argumente verfestigt wird.
Zahlreiche Studien zeigen, dass die queere Community eine relativ häufig durch Gewalt und Diskriminierungen belastete Gruppe ist. Betroffen von Gewalt und Diskriminierungen sind insbesondere Personen, die in weiteren Bereichen zusätzlich marginalisiert sind[3]. Um dieser Gewalt etwas entgegenzusetzen, entwickeln wir als queere Personen manchmal kompensatorisch Ideale von besonderer Stärke und Autonomie. Es macht einen gewissen Sinn für queere Personen, Schwäche, eigenes Leiden und eigene Irrtümer wiederum eher zu dethematisieren, auch, um nicht psychopathologisierende Vorurteile der Heterogesellschaft zu bestätigen. Gestehen wir uns aber selbst nicht ein, dass wir in schwierigen Situationen fehlerhaft oder irrtümlich handeln und in Fettnäpfchen treten können, verlieren wir im Konfliktfall unsere Differenzierungsfähigkeit und auch das gegenseitige Wohlwollen. Dann können Konflikte rasch eskalieren und zu Spaltungen führen. Konflikte in queeren Communitys sind für die darin involvierten Personen oft auch deshalb so verletzend, weil sie durch die projektiven Prozesse als intentional und eindeutig böse stilisiert werden. Eine solche Einordnung ist schmerzhaft. Die betroffene Person kann dies oftmals kaum integrieren. Es zerreißt das eigene Identitäts-Konstrukt und bedroht die soziale Zugehörigkeit. Es kann auch passieren, dass diejenigen, auf die sich die Zuschreibung einer bösen Intention richtet, aus Räumen ausgeschlossen werden. So entstehen dann Kämpfe um den Zugang zu Räumen (Wer darf welchen Raum, welche Veranstaltung betreten?), anstatt dass eine Klärung im ehrlichen Dialog versucht wird. Dadurch werden auch Leute aus Communitys ausgeschlossen, denen zuvor keine Möglichkeit geboten wurde, sich zu erklären, sich zu entschuldigen, sich zu verteidigen. Ich sehe hier leider auch entsprechend kritische Entwicklungen in manchen Awareness-Strukturen. Dass diese manchmal Menschen anzielen, ohne sie anzuhören, läuft meinem Verständnis von Awareness konträr. Auch das Konzept von Definitionsmacht ist in diesem Kontext problematisch. Definitionsmacht gibt der Person, die als böse markiert wird, keine Möglichkeit mehr zu zeigen, wer sie ist und was ihre Absichten sind. Definitionsmacht und Awareness-Strukturen sind vom Grundverständnis her gut gemeint und sollen eigentlich vor Gewalt schützen. Und trotzdem können sie auch manchmal so eingesetzt werden, dass sie Ausgrenzung und Silencing eher verstärken.
VH:
Mit Awareness-Strukturen meinst du Callouts und Cancel Culture?
GFW:
Genau. Mari Günther, Kirsten Teren und ich haben uns in unserem Buch über Trans*gesundheit[4] auch mit Community-Konflikten auseinandergesetzt und z.B. solche Konstellationen beschrieben wie: eine Person geht in irgendeinen Community-Ort, jemand anders ist der Meinung, dass diese Person sich problematisch verhalten hat und ruft eine Awareness-Struktur zu Hilfe und sagt: Diese Person hat sich gewalttätig, stalkend oder übergriffig verhalten. Die Awareness-Gruppe sieht dann ihre Aufgabe darin, die Person rauszuschmeißen. Und die entsprechend markierte Person hat, weil sie in dem Paradigma von Definitionsmacht keine Möglichkeit hat dagegenzuhalten, keine Möglichkeit sich zu verteidigen. Damit entstehen Ungerechtigkeiten und Kommunikationsbrüche in der Community.
VH:
Hast du dafür eine Lösung?
GFW:
Also mein Wunsch wäre, dass die Community viel mehr über Trauma- und Konfliktdynamiken redet. Also: was machen wir da miteinander vor dem Hintergrund dessen, was wir leidvoll erfahren haben. Es gibt viele Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, warum queere Leute so schlecht miteinander umgehen. Solche Überlegungen gibt es ja auch in anderen Communitys, z.B. in BDSM-Communitys. Und ich würde mir wünschen, dass es eine Aufklärung gibt über solche Dynamiken, dass Leute einfach mehr auf dem Schirm haben, dass eine Person, die im Konflikt als Übeltäter*in markiert wird, manchmal vielleicht gar nicht die Übeltäter*innenperson ist, sondern dass da Wahrnehmungen aus anderen Kontexten mit reinspielen und zu Projektionen führen können. In den marginalisierten Communitys müssen wir einen sehr kritischen Umgang mit Ausschluss-Prozessen finden. Wir müssen eher lernen, auch in massiven Konflikten wirklich hören zu wollen, was die andere Seite sagt, also exakt nachfragen lernen, einander unterstützen und so weiter. Und wir müssen uns Mühe geben, nicht allzu polar übereinander zu reden und uns dem zu stellen, dass wir alle Fehler machen können. Mir ist auch wichtig, dass wir unsere Wahrnehmung zu tatsächlicher Gewalt in Communitys schärfen. Es passiert immer wieder, dass ein Konflikt irrtümlich für eine Gewaltsituation gehalten und auch entsprechend etikettiert wird. Genauso passiert es, dass tatsächliche Gewalt in Communitys übersehen wird und die Beteiligten nicht die Unterstützung und Ansprache erhalten, die sie bräuchten, um eine gewaltvolle Situation zu beenden.
Sarah Schulman und auch die Autor*innengruppe im Sammelband The Revolution starts at Home haben zahlreiche gute Vorschläge dazu gemacht, was Menschen machen können, die einen Konflikt wahrnehmen, aber nicht mittendrin sind, also z.B. Freund*innen von zwei Personen, die sich massiv in die Haare kriegen. Leute, die nicht massiv involviert sind und die aufgefordert werden, von irgendeiner Seite, sich an der Ausgrenzung der anderen zu beteiligen, können lernen innezuhalten und genau nachzufragen, was los ist. Sarah Schulman (2016) hat dafür folgendes Beispiel benannt: Jemand hört z.B., dass eine Person A angeblich eine Person B stalkt, daraufhin erfolgt der Aufruf, die vermeintlich stalkende Person A aus der Kommunikation auszugrenzen. Das wäre ein Punkt, wo innegehalten und nachgefragt werden sollte: Was ist eigentlich genau passiert? Wie kommt es dazu, dass das so eskaliert? Gibt es da Beziehungskonflikte? Gibt es innere Konflikte? Wie geht es allen Beteiligten? Im Konfliktfall hat jede Seite Unterstützung verdient. So kann das Umfeld schauen: Wer spricht die Person an, die angeblich stalkt? Denn nur so können ja Leute, die tatsächlich stalken, auch identifiziert werden und diejenigen, die fälschlich beschuldigt werden, da auch wieder reingeholt werden in die Community.
Durch Spaltungen und Rechthabenwollen kann auch ein Klima erzeugt werden, in dem es im Konfliktfall niemand mehr wagt zu sagen: Verdammt, ich merke, ich habe hier einen inneren Konflikt, den trage ich nach außen. Weil die Person Angst hat zu benennen, dass sie auch an der Dynamik beteiligt ist und sich auch scheut, das eigene Leid, welches dahinterliegt, sichtbar zu machen. Bei Traumatisierungen verwebt sich ja das Sprechtabu leider auch mit einem ganz ungünstigen gesellschaftlichen Diskurs. Die evangelikale Rechte und auch die Psychoanalyse waren (z.T. sind) ja leider sehr engagiert darin, queeren Menschen pauschal zuzuschreiben, sie seien alle traumatisiert. Deswegen macht es einen gewissen Sinn, dass die queere Community quasi in einem Abwehrreflex versucht, möglichst stark nach außen auszusehen. Damit verschieben wir aber auch in die Unsichtbarkeit, wenn an einem massiven Community-Konflikt vielleicht auch schlimme Lebensgeschichten von Personen beteiligt sind. Ich kann auf der einen Seite diese Stigmaabwehr-Bewegung verstehen. Auf der anderen Seite finde ich, ein Sprechtabu hilft uns nie, realistisch mit Sachen umzugehen. Das nützt uns nichts. Wir müssen eher lernen, offen darüber zu sprechen.
VH:
Ich beobachte, dass der Traumabegriff allmählich in den Communitys diskursiviert wird. Sind wir als queere Community alle kollektiv traumatisiert? Verursacht das Leben als queere* Person in unserer derzeitigen Wirtschafts- und Gesellschaftsform an sich schon Entwicklungstrauma?
GFW:
Ich denke nicht, dass alle Mitglieder der queeren Community traumatisiert sind. Die These, wir seien alle traumatisiert, inflationiert den Traumabegriff und banalisiert die Auswirkungen von Traumatisierungen. Ich glaube, manche Menschen in den queeren Communitys sind traumatisiert. Darunter verstehe ich, entsprechend der psychotherapeutischen Definition – die ich in diesem Kontext wirklich hilfreich finde – folgendes: Jemand ist traumatisiert, der wirklich ein lebensbedrohliches Ereignis erlitten oder ein Ereignis erlebt hat, bei dem andere Menschen lebensbedrohlich bedroht waren, die dem Menschen am Herzen lagen. Ein Entwicklungstrauma macht sich daran fest, dass ein Mensch eine Situation aufgrund seines Entwicklungsstandes nicht bewältigen kann und diese Situation für ihn dann hochbedrohlich wird. Ein Beispiel dafür wäre ein sehr kleines Kind, das für Stunden alleine in einem Zimmer gelassen wird. Das Verschwinden der Erwachsenen kann das Kind in eine potenziell lebensgefährliche Situation bringen. Ein anderes Beispiel könnte die schwulenfeindliche Beschimpfung einer Person im Alter von 15 Jahren sein, die schon vorvulnerabilisiert und allein in der Situation ist, weil andere nicht hinter ihr stehen oder sie erleben muss, dass die Lehrkräfte den Beschimpfungen zustimmen und nicht helfen. Wenn diese Person dann aus Verzweiflung über die Aussichtslosigkeit der Situation in eine suizidale Krise gerät, kann auch ein schwulenfeindliches Beschimpfen letztlich lebensbedrohlich wirken. Solche Ereignisse können von einer anderen Person, die ein gutes queeres Unterstützungsnetzwerk hat, vielleicht halbwegs weggesteckt werden. Ich glaube, dass es wichtig ist zu differenzieren. Es gibt auf der einen Seite in der Community Menschen, die relativ glatt durchgekommen sind, ich sage hier bewusst ‚relativ‘, weil Hetero-und Ciszentrismus und Sexismus eben keine guten Bedingungen für queere Menschen darstellen. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die in diesem gesamtgesellschaftlichen Kontext massive und auch traumatische Verletzungen erlitten haben. Ich finde, dass es uns hilft, wenn wir sorgfältig mit Begriffen sind, und dass wir dann auch passender handeln können. So ist es mir auch wichtig, bei der Thematisierung von Triggern genau hinzugucken: wird jemand tatsächlich getriggert, also verfällt eine Person ohne Steuerungsmöglichkeit durch einen Hinweisreiz in einen Zustand, der mit einer traumatischen Reaktion verknüpft ist? Oder ist es eine Person, die ein Unwohlsein mit dem Wort triggern belegt, und so bewirken möchte, dass andere intervenieren, damit sie von dem Unwohlsein verschont wird.
VH:
Welcher Begriff ist für marginalisierte Gruppen passend, um die Auswirkungen der Belastungen zu beschreiben?
GFW:
Wir haben alle Minority-Stress[5], auch der cis Schwule und die cis Lesbe. Das wäre das Wort, was ich durchaus für alle benutzen würde in unterschiedlichem Schweregrad. Aber nur einige von denen, die gleichzeitig Minority-Stress haben, haben auch eine Traumatisierung.
VH:
Kann Hass als eine Reaktion des autonomen Nervensystems angesehen werden? Also als direkte Reaktion oder als Folge von vorherigen Traumata?
GFW:
Das würde ich nicht so sagen. Jeder Mensch, der andere hatet, kann in einem angespannten Zustand sein. Das kann gehen bis zur maximalen Anspannung und zu maximalem Stress. Aber aus dem Ausmaß des Hasses auf das Ausmaß der Anspannung eins zu eins zu schließen finde ich nicht angebracht. Jemand kann durchaus in der Lage sein, auf der einen Seite einen tödlichen Hass auszuleben, auf der anderen Seite aber eigentlich nicht getriggert zu sein, sondern sich, wenn es ihm opportun erscheint, wieder in den Normalzustand zurückzubeamen. Auch hier ist es sinnvoll exakt hinzugucken: Wenn jemand zum Beispiel massiven Hass gegen eine ehemalige Partner*inperson formuliert und zwei Stunden später entspannt zum Beispiel wieder ihrer*seiner Freizeitaktivität nachgehen kann, dann ist das etwas, was ich anders einordnen würde, als eine Person, die massiv hatet und in großer Anspannung ist und zwei Stunden später immer noch funktionsunfähig ist. Der Umgang damit sollte ein anderer sein. Die Person, die überhaupt nicht mehr runterkommt, braucht tatsächlich eine Art von schützendem Kokon und muss rausgebracht werden aus der Situation. Die Person, die switchen kann, hat mehr Verantwortung für ihr Verhalten und sollte anders angesprochen werden. Die erste Person ist nur noch begrenzt verantwortungsfähig. Die zweite ist sehr wohl in der Lage, verantwortlich zu handeln.
VH:
Ich würde gerne mal auf das JAHR DER FRAU_EN zu sprechen kommen. Wie hast du es empfunden, was hast du mitbekommen?
GFW:
Leider eigentlich gar nicht viel.
VH:
Das ist interessant. Die queeren Berliner Communitys sind so vielfältig. Ich gebe dir kurz etwas Kontext: Wir hatten das JAHR DER FRAU_EN am 1.1.2018 über eine Pressemitteilung ausgerufen und da ging es gleich schon los. Viele cis Schwule gingen auf die Barrikaden. „Die Lesben übernehmen das Museum“, „die Lesben bereichern sich an unserem Erkämpften“ empörten sie sich. Das zog sich durch das gesamte Jahr. Es gab eigentlich keine ernsthafte Auseinandersetzung mit unserem Anliegen, nämlich sich gemeinsam gegen Sexismus in der Kunst, Kultur, Gesellschaft und auch der queeren Communitys und im Schwulen Museum auszusprechen. Es wurde auch nicht das persönliche Gespräch mit uns gesucht, stattdessen in Social Media und in Artikeln heftig angestachelt. Initiiert und befeuert wurde dies von ein paar bekannten Protagonist*innen der schwulen und auch den lesbischen Communitys. Die Diskreditierung traf hauptsächlich uns zwei weiblich gelesene Vorstände und Hauptkurator*innen. Es wurden die Feminist*innen wohlbekannten Standardressentiments herausgekramt und an unserer fachlichen Kompetenz gezweifelt. Die Mißgunst ging soweit, dass falsche Gerüchte über mein Gender und meine sexuelle Orientierung geschürt wurden, um diese dann öffentlich als nicht vorstandswürdig abzuqualifizieren.
Ein Shitstorm folgte dem nächsten, immer wieder wurde den aggressiven Anmaßungen in den Communitys und in den Medien eine Bühne gegeben. Auffallend war, dass es so wenig öffentlich agierende Kompliz*innen gab, die sich auf unsere Seite stellten. Einige, die es versuchten, wurden gleich wieder zurückgepfiffen. Ein paar von ihnen schrieben mir, sie könnten es sich schlichtweg nicht leisten, uns zu unterstützen; es wäre zu schwierig, da durchzukommen und sie hatten Angst um ihren Ruf und damit auch ihre finanzielle Sicherheit. Das was uns entgegenschwappte befand sich in einer juristischen Grauzone zwischen Rufschädigung, Beleidung und Meinungsfreiheit, zumindest wurde mir das damals so gesagt. Mittlerweile wird das vielleicht anders beurteilt. Was mich richtig erschüttert hat war, wie vehement und aggressiv sich plötzlich Leute, die sich eigentlich eher an der Peripherie des Museums bewegen, in Sprecher*innenrollen begaben und sehr uninformiert und platt Meinung machten. Kein einziges Mal besuchten sie tatsächlich das Museum. Das muss mensch sich auch erst mal trauen. Und ich frage mich auch, was so dermaßen schlimm für einige schwule cis Männer daran ist, sich mal ein Jahr lang FLINTA* Themen in einem Museum für queere Geschichte, Kunst und Kultur anzuschauen? Die FLINTA* Communitys haben sich ja umgekehrt jahrzehntelang ihre Geschichte über schwule Erzählungen (mit-)erklären lassen müssen. Die LGBTQIA+ Communitys saßen auf einem Pulverfass und in 2018 ist es explodiert wie mir schien. Und das nicht nur bei uns, da gab es ja auch andere heiß debattierte Vorkommnisse in anderen bekannten Projekten.
GFW:
Oh, das tut mir entsetzlich leid. Das klingt bitter. Ich habe diesen Konflikt ja leider gar nicht so mitbekommen. Hier würde ich darauf achten, wie durch den verwendeten Diskurs Opfer- und Täter*innenpositionen geschaffen und verfestigt werden. Und vielleicht ließe sich in diesem Falle auch das anwenden, was Sarah Schulman über supremacy schreibt. Was dann passieren kann ist, dass sich die privilegierten Personen, also die cis Schwulen oder cis Lesben, als Opfer stilisieren. Es gibt auch eine sozialpsychologische Forschungsarbeit, deren Erkenntnisse aus diesem Konflikt einen Weg hinaus weisen könnten: diejenigen die am allernächsten dran sind haben am meisten Einfluss auf die Person, die die supremacy ausspielt.[6] Das heißt, es wäre schön, es gäbe es ein paar cis Schwule, die in solchen Konflikten sagen: „Leute, geht’s noch?!“ Und eventuell hat es diese auch gegeben?
VH:
Also FLINTA* haben gar keine Chance?
GFW:
Doch, sie können sagen: „Liebe Schwule, wir denken nicht, dass die einzige Meinung, die in eurer Community herrscht, ist, dass das JAHR DER FRAU_EN eine ganz große Blamage ist. Bitte meldet euch.“ Und natürlich können FLINTA* auch in alle Richtungen Dialog anbieten und all das tun, was wichtig ist, um ungerechtfertigte Privilegierungsstrukturen auszuhebeln.
VH:
Vielen Dank für diese spannenden Einsichten und deine Arbeit. Mögen wir gemeinsam auf friedlichere Zeiten hinarbeiten.
Das Interview wurde am 18.09.2019 geführt und im April 2022 ausgearbeitet.
___________________________
[1] I. Hax, S. Reiß/ Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (Hg.): Vorstudie. Programmatik und Wirken pädosexueller Netzwerke in Berlin – eine Recherche, https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/Vorstudie_Programmatik-und-Wirken-paedosexueller-Netzwerke_Auarbeitungskommission.pdf (letzter Abruf: 03.04.2022)
[2] Vgl. z.B. S. Schulmann: Conflict is not abuse. Overstating harm, community responsibility, and the duty of repair (Vancouver 2016).
K.C. Thom: Why are queer People so mean to each other? How brain science explains queer trauma, conflict and call-out-culture, https://www.dailyxtra.com/why-are-queer-people-so-mean-to-each-other-160978 (letzter Abruf: 03.04.2022).
C. I. Chen, J. Dulani & L. L. Piepzna-Samarasinha (Hg.): The Revolution starts at home. Confronting intimate violence within activist Communities (Chico 2016).
[3] Vgl. hierzu die aktuellen Daten aus: S. Timmermanns, N. Graf, S. Merz, H. Stöver: „Wie geht`s euch?“ Psychosoziale Gesundheit und Wohlbefinden von LSBTIQ*(Weinheim/ Basel 2022).
[4] M. Günther, K. Teren,G. Wolf: Psychotherapeutische Arbeit mit trans* Personen, Handbuch für die Gesundheitsversorgung (München 2021).
[5] Vgl. zum Konzept des Minority-Stress I. H. Meyer: Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: Conceptual Issues and Research Evidence, Psycholological Bulletin 129 (5) (2003) 674-993.
[6] B. J. Drury, C.R. Kaiser: Allies against Sexism: The Role of Men in Confronting Sexism, Journal of Social Issues, Vol. 70, No. 4 (2014)637-652.
