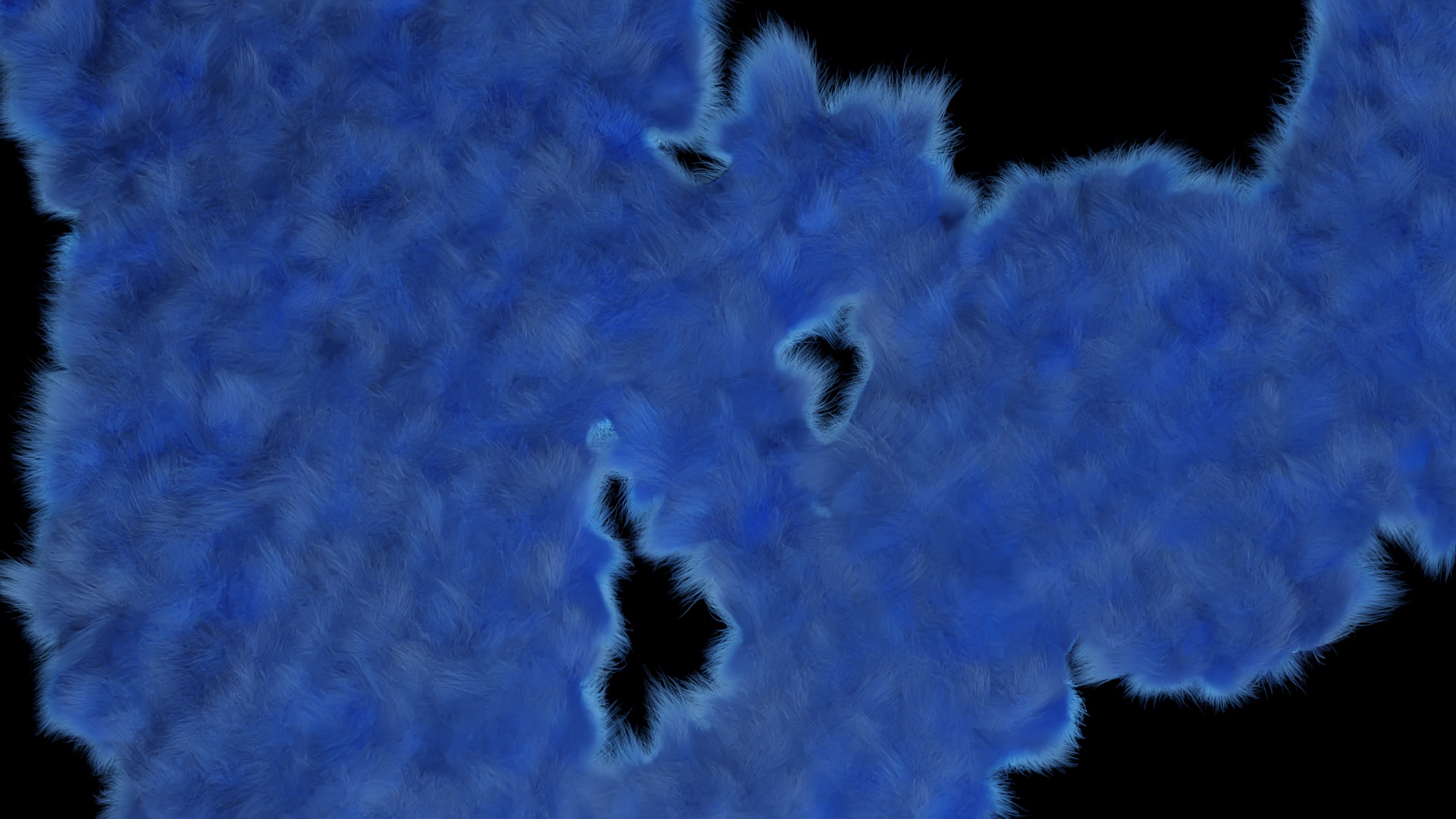
Schriftgröße anpassen
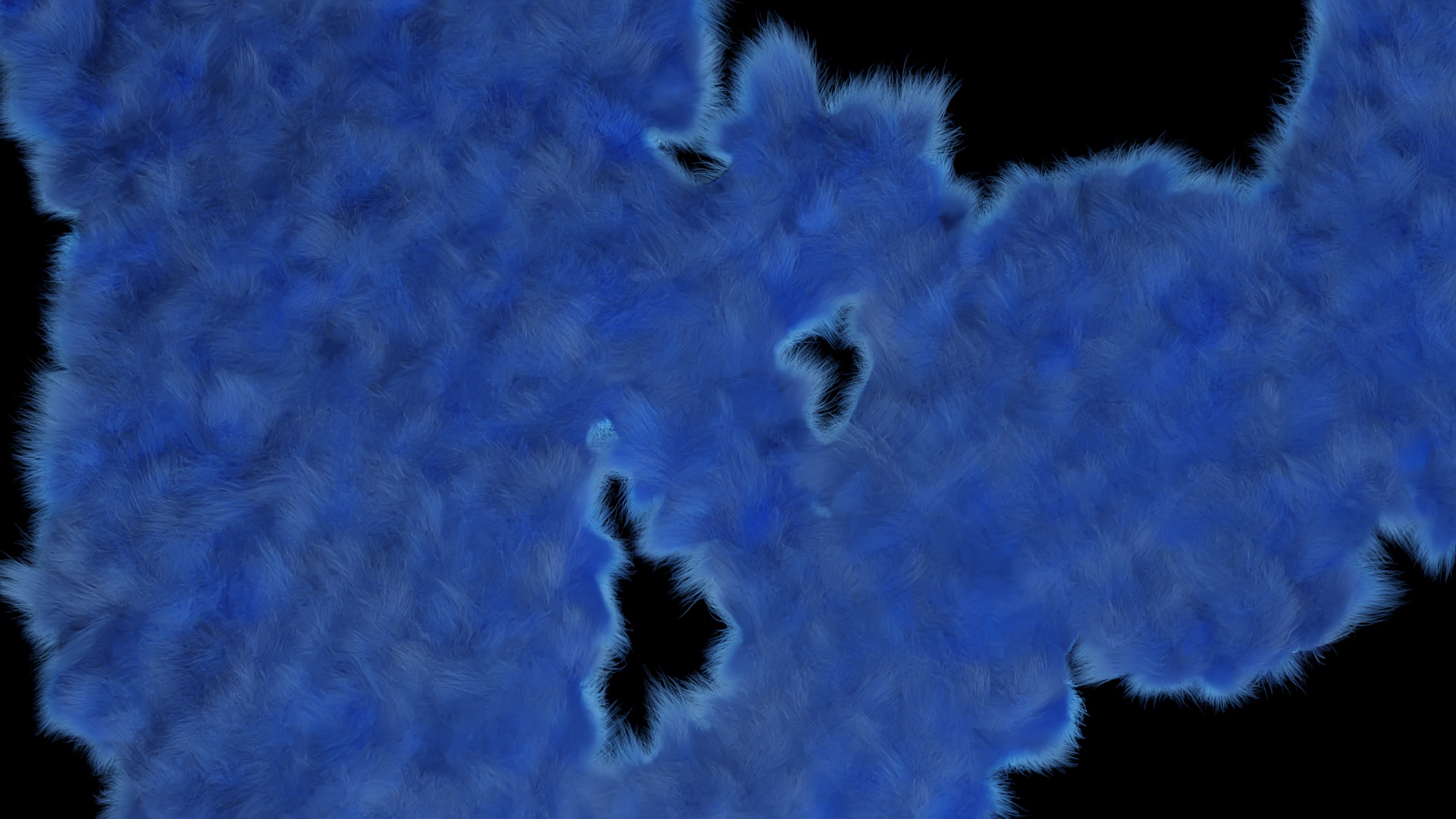
1918–2018: 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland
Das Jahr der Frau_en im Schwulen Museum in Berlin, war zugleich das Jahr, in dem wir 100 Jahre Wahlrecht für Frauen feiern konnten. Der Rat der Volksbeauftragten, der im Zuge der revolutionären Ereignisse nach dem Ersten Weltkrieg ab 10. November 1918 die höchste Regierungsgewalt innehatte, erklärte am 12. November 1918 eindeutig: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht (...) für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“ Mit der Formulierung „alle männlichen und weiblichen Personen“ war eine Forderung der Frauenbewegungen erfüllt, für die sie, wenn auch von unterschiedlichen Standpunkten aus und mit unterschiedlichen Zielsetzungen, jahrelang mit viel Ausdauer, Mut und Fantasie gekämpft hatten.
Ein langer, schwieriger Kampf
Die Frauen in Deutschland haben das Wahlrecht nicht geschenkt bekommen. Es war ein langer Frauen- und Klassenkampf, bis zu seiner Durchsetzung. Denn gerade in dieser Frage bestand „ein enormer Unterschied zwischen arbeitenden Frauen und den besitzenden Ladies, zwischen einer Dienerin und ihrer Herrin“, wie es Alexandra Kollontai 1913 in der Prawda formuliert hatte. Ohne den internationalen Kampf der Sozialistinnen wäre das Frauenwahlrecht nicht durchgesetzt worden. Hartnäckig mussten sie an drei ‚Fronten‘ kämpfen: gegen die Repressalien der Behörden, gegen die Frauenfeindlichkeit mancher Genossen und gegen viele ihrer bürgerlichen Geschlechtsgenossinnen. In vielen Veröffentlichungen zum 100. Jahrestag wurden vor allem Frauen aus der bürgerlichen Frauenbewegung, die für das Stimmrecht kämpften, hervorgehoben. Vergessen wird der Kampf der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung. Zwar forderte Louise Otto (1819–1895), die Begründerin der bürgerlichen Frauenbewegung, bereits 1843 in den Sächsischen Vaterlandsblättern „die Theilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben“, das Frauenwahlrecht betrachteten sie und ihre Mitstreiterinnen jedoch als Fernziel. Sie fürchteten, dass die meisten Frauen noch nicht in der Lage wären, das Recht selbstständig zu nutzen, sondern stattdessen Interessenverbände und Parteien die Frauen für ihre Zwecke instrumentalisieren könnten. Deshalb setzten sie sich zunächst für bessere Bildung für Frauen ein. Anders die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831–1919): Sie rief in ihrem Text Der Jesuitismus im Hausstande von 1873 den Frauen zu: „fordert das Stimmrecht, denn über das Stimmrecht geht der Weg zur Selbständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück der Frau.“ Damit war sie ihrer Zeit weit voraus; Politik gehörte damals nicht zum bürgerlichen Frauenideal.
Der ‚radikale Flügel‘ der bürgerlichen Frauen trat für gleiche politische Rechte als Voraussetzung zur Gleichstellung der Frauen in allen Bereichen von Staat und Gesellschaft als ein ‚natürliches Recht‘ ein. Die ‚gemäßigten Bürgerlichen‘, seit 1894 im Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) zusammengeschlossen, stritten darum, ob Frauen ein allgemeines Wahlrecht einfordern sollten – das bis 1918 in Preußen nicht einmal die Männer der unteren Schichten hatten – oder ob sie die Anpassung an die Rechte ‚ihrer‘ Männer fordern sollten, d.h. ein Wahlrecht nach drei oder vier Klassen, und damit ein beschränktes „Damenwahlrecht“, wie Clara Zetkin es beschrieb.
Die völlig rechtlose Situation der Arbeiterinnen und Dienstmädchen nahmen sie nicht in den Blick. Auch die ‚radikalen‘ unter den bürgerlichen Frauengruppen kooperierten nur punktuell mit sozialistischen Frauengruppen. So kam es kaum zu gemeinsamen Aktionen, eher zu Behinderungen. Für die bürgerlichen Frauen war es ohnehin schwierig, zum Wahlrecht eindeutig Stellung zu beziehen, ohne damit den Bezug zu einer Partei herzustellen. Bis zur Durchsetzung des Frauenwahlrechts waren es lediglich die beiden sozialdemokratischen Parteien MSPD und USPD, die sich dafür einsetzten. Und ‚zu denen‘ wollten sie nicht gehören.
Auf der Frauenstimmrechtskonferenz 1899 in London schlossen sich sowohl Anhängerinnen eines eingeschränkten wie auch eines allgemeinen Wahlrechts zusammen. Erst 1902 gründeten Anita Augspurg (1857–1943) und Lida Gustava Heymann (1868–1963) in Hamburg den Verein für Frauenstimmrecht. 1904 nahm der Verband unter Ausschluss der Sozialistinnen am Internationalen Frauenstimmrechtskongress in Berlin teil. Auf dem Kongress wurde der Weltbund für das Frauenstimmrecht unter dem Vorsitz von Marie Stritt (1855–1928) gegründet. Der Weltbund verfolgte strikte Neutralität in der Frage, welche Frauen von den Wahlrechtserweiterungen profitieren würden. Das förderte Marie Stritts Popularität, verhinderte aber eine einheitliche ‚Marschrichtung‘ der ‚Bürgerlichen‘.
Der Interessengegensatz zwischen Proletarierinnen und ‚Bourgeoisdamen‘ schien unüberwindlich. Viele konservative Frauen hielten die Forderung bis in die Zeit des ersten Weltkrieges hinein für verfrüht, weil der öffentliche Widerstand gegenüber Frauen in der Politik zu groß erschien. Oder sie hielten ohnehin an der ‚natürlichen‘ Bestimmung der Frau*, die ihren Platz in der Familie finden sollte, fest. Zu ihnen zählte der Deutsch-Evangelische Frauenbund, der noch 1917 aus dem Bund Deutscher Frauenvereine austrat, weil er die Forderung nach dem allgemeinen Frauenstimmrecht, die dieser inzwischen vertrat, nicht mittragen wollte.
Frauenwahlrecht und proletarische Frauenbewegung
Für die proletarische Frauenbewegung stand das Frauenwahlrecht von Beginn an auf dem Programm und war eingebunden in die Debatten um eine allgemeine Wahlrechtsreform. Nach dem Motto: „Können wir nicht wählen, so können wir doch wühlen!“, beteiligten sich viele Frauen an den Wahlkämpfen sozialdemokratischer Landtags- und Reichstagsabgeordneter. Sie wollten damit der Partei zum Sieg verhelfen, die ihre Anliegen unterstützte, und das war damals die SPD.
Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde das allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime – aktive und passive – Wahlrecht für alle männlichen Bürger über 25 Jahre, die im Besitz der bürgerlichen und politischen Ehrenrechte waren, für den Reichstag eingeführt. Ausgeschlossen waren nicht nur diejenigen, denen durch Richterspruch die staatsbürgerlichen Rechte entzogen waren, sondern auch die Armenunterstützungsempfänger. Alle Frauen blieben rechtlos. Bei den Wahlen zum Preußischen Haus der Abgeordneten galt bis zum Ende des Kaiserreichs weiter das Dreiklassenwahlrecht. Die Männer jedes Wahlbezirkes wurden danach in drei Gruppen aufgeteilt, auf die je ein Drittel des gesamten Steueraufkommens entfiel. Jede der Gruppen wählte die gleiche Anzahl von Abgeordneten, so dass wenige Vermögende über das gleiche Gewicht verfügten, wie die große Masse der Besitzlosen.
Auf dem Internationalen Arbeiterkongress, der vom 14. bis 20. Juli 1889 in Paris tagte, und der als Gründungskongress der II. Internationale in die Geschichte eingegangen ist, forderte Gertrud Guillaume-Schack (1845–1903) – unterstützt durch Clara Zetkin (1857–1933) und Emma Ihrer (1857–1911) – das uneingeschränkte Frauenstimm- und Wahlrecht. Die Proletarierinnen wussten, dass sie von den bürgerlichen Frauen keine Unterstützung zu erwarten hatten: „Die Arbeiterfrauen“, so Clara Zetkin auf dem Kongress, „welche nach sozialer Gleichheit streben, erwarten für ihre Emanzipation nichts von der Frauenbewegung der Bourgeoisie, welche angeblich für Frauenrechte kämpft.“ Etwa zwei Jahrzehnte später verwies sie auf der sozialistischen Frauenkonferenz in Mannheim 1906 darauf, dass „die Forderung der Frau, als Persönlichkeit mittels des aktiven und des passiven Wahlrechts den ihr gebührenden Platz in Staat und Gemeinde auszuüben“, ihre wichtigste treibende Kraft durch die wirtschaftliche Entwicklung und durch die kapitalistische Produktion erhalten habe. Nun gelte es, das System zu bekämpfen, denn die völlige Gleichstellung der Frau sei auf dem Boden der bestehenden Ordnung unmöglich. Den Sozialistinnen ging es nicht um den ‚Kampf gegen die Männerwelt ihrer Klasse‘, sondern um den gemeinsamen Kampf gegen den Kapitalismus. Daran hatten die Bürgerlichen kein Interesse. Zetkin hielt ohnehin nichts von einer „Allerweltsbasenschaft“. Sie sah keine Gemeinsamkeiten mit „Frauenrechtlerinnen“, die das „große und verwickelte Problem der Frauenbefreiung nicht in seinen vielverzweigten sozialen Zusammenhängen erfassen, vielmehr aus den Interessen der bürgerlichen Gesellschaft betrachteten“, wie sie später in ihrem Buch Zur Geschichte der Proletarischen Frauenbewegung Deutschlands schrieb. Auch Luise Zietz (1865–1922), damals im Parteivorstand der SPD, ging 1912 in ihrer Schrift Die Frauen und der politische Kampf mit den bürgerlichen ‚Schwestern‘ zu Gericht, weil diese sich mit einem ‚beschränkten Frauenwahlrecht‘ zufriedengeben und sich nicht darum kümmern würden, wenn die große Masse der Proletarierinnen weiter in politischer Rechtlosigkeit gehalten würde.
Viele Sozialistinnen, die in Deutschland für ihr Anliegen kämpften, wurden gesellschaftlich geächtet, diskriminiert und verfolgt und nicht selten ins Gefängnis geworfen. Das erklärt auch die Tatsache, dass die proletarische Frauenbewegung zunächst „klein und engmaschig“ war und die Frauenkonferenzen, die um die Jahrhundertwende stattfanden, keine Massenveranstaltungen waren. Schließlich war von 1878 bis 1890 Bismarcks „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Social-Demokratie“ in Kraft, das sämtliche Basisaktivitäten von Parteien, Gewerkschaften und anderen sozialistischen Zusammenschlüssen betraf und auch nach seiner Auflösung 1890 das gesellschaftliche Klima als Grundstimmung gegen die geächteten Sozialistinnen weiter mitprägte. Sozialistische Frauen waren einer doppelten Unterdrückung und Verfolgung durch die Staatsgewalt ausgesetzt, weil Frauen erst seit 1908 mit Inkrafttreten des Reichsvereinsgesetzes einer politischen Partei oder Organisation beitreten konnten. Keine der führenden Frauen der proletarischen Frauenbewegung blieb von Verfolgung verschont, während viele ‚Bürgerliche‘ beinahe ungehindert konservative Politik betreiben konnten.
Widerstand zunächst auch bei den Sozialdemokraten
Erst nach 1908 durfte der Wahlrechtskampf offen und offensiv geführt werden. Wen wundert es, dass auch die Arbeiterinnen aus den Reihen der männlichen Arbeiter wenig Fürsprecher hatten? Schließlich begehrten auch viele männliche Sozialisten eine ‚Hausfrau‘ nach bürgerlichem Vorbild. Sie fürchteten gerade die Selbständigkeit der Frau, die durch das Stimmrecht erhofft wurde: „Es gibt Sozialisten, die der Frauenemanzipation nicht weniger abgeneigt gegenüberstehen, wie der Kapitalist dem Sozialismus“, schrieb August Bebel (1840–1913), Parteivorsitzender der SPD in seinem Buch Die Frau und der Sozialismus bereits 1879.
Schon 1875 hatte er auf dem Gothaer Parteitag der SPD beantragt, der Forderung nach dem allgemeinen, gleichen, geheimen Wahlrecht für alle Staatsbürger, die Forderung nach dem Wahlrecht für Frauen hinzuzufügen. Durchsetzen konnte er sich damit (noch) nicht. Ausdrücklich betonten die sozialdemokratischen Männer, dass die Ablehnung nicht aus prinzipiellen Gründen gegen das Frauenwahlrecht erfolgte, sondern aus „taktischen“ Erwägungen: Sie erwarteten keinen Kräftezuwachs für ihren Kampf durch die Mobilisierung von Frauen. Im Gothaer Programm hieß es: „Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht mit geheimer und obligatorischer Stimmabgabe aller Staatsangehörigen vom 20. Lebensjahre an.“ Alle Staatsangehörigen waren alle Männer.
Erst auf dem Parteitag 1891 in Erfurt konnte Clara Zetkin die (meisten) Genossen davon überzeugen, dass „allgemein und gleich“ auch die Frauen einschließen müsse. Im Parteiprogramm hieß es jetzt: „ohne Unterschied des Geschlechts“.
Die Formulierung musste nun in den Reichstag eingebracht werden und dem gehörten bis zum Ende des Kaiserreichs keine Frauen an. August Bebel musste es 1895 ertragen, dass er bei den Männern aller übrigen Parteien Heiterkeit für sein Anliegen erntete, als er gemeinsam mit Ignaz Auer (1846–1907) einen Gesetzentwurf in den Reichstag einbrachte, der die Einführung des Frauenstimmrechts zum Inhalt hatte. 1906 wurde derselbe Antrag als Gesetzentwurf Albrecht und Genossen wiederholt, durch Eduard Bernstein (1850–1932) begründet und erneut abgelehnt. Die Klassenschranken waren unüberwindbar und bildeten die Grenzlinie zwischen bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung.
Sozialdemokratinnen internationalisierten den Kampf
Auf der SPD-Frauenkonferenz 1906 in Mannheim wurde der Beschluss gefasst, die Forderung nach Frauenstimmrecht in den Mittelpunkt der SPD-Politik zu stellen, ohne Rücksicht auf taktische Überlegungen. In der Zwischenzeit hatten die SPD-Frauen erkannt, dass das Problem auf nationaler Ebene nicht zu lösen war. Auf der ersten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1907 in Stuttgart legten die Sozialistinnen eine einheitliche Marschroute für den Frauenwahlrechtskampf fest. Die Parteien aller Länder verpflichteten sich, sich energisch für die Einführung des uneingeschränkten allgemeinen Frauenwahlrechts einzusetzen. Auf Vorschlag von Luise Zietz wurde ein Internationales Frauensekretariat gegründet. Zur Sekretärin wurde Clara Zetkin gewählt.
Bei der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 26. und 27. August 1910 in Kopenhagen brachte Clara Zetkin gemeinsam mit Gertrud Hanna (1876 – 1944), damals Leiterin des Frauensekretariats bei der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands die Durchführung eines Frauentags zur Abstimmung, „der in erster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht“ dienen sollte. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Das Frauenwahlrecht wurde in den Zusammenhang mit der ‚ganzen Frauenfrage‘ gestellt. Dazu gehörten Arbeiterinnenschutz, soziale Fürsorge für Mutter und Kind, die Gleichbehandlung von ledigen Müttern, die Bereitstellung von Kinderkrippen und Kindergärten und die internationale Solidarität. Auch das unterschied sie von der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung, die glaubte, mit dem Frauenwahlrecht hätte sie die Emanzipation der Frauen durchgesetzt.
Der Frauentag 1911 wurde ein voller Erfolg. „Eine wuchtige, sozialdemokratische Kundgebung für das Frauenwahlrecht“, so geht es aus einem Bericht des SPD-Parteivorstandes hervor. Etliche Frauen der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung nahmen an den Veranstaltungen teil oder überbrachten Grußadressen. Da sie sich in diesem Falle hinter die Forderungen der proletarischen Bewegung stellten, war ein vereintes Demonstrieren möglich. Die Gleichheit berichtete am 27. März 1911: „Zahlreiche Polizeimannschaften in der Nachbarschaft der Versammlungslokale bewahrten revolvergerüstet die Stadt [Berlin] vor dem Umsturz der Frauen“. In vielen anderen Orten des Reiches fanden Versammlungen statt, auf denen Resolutionen zum Frauenstimmrecht beschlossen wurden. Bürgerliche Depeschenbüros schätzten die Zahl der Teilnehmer*innen auf 30.000 – „höchstwahrscheinlich gut über die Hälfte zu niedrig“, vermutete Die Gleichheit.
Außer in Deutschland wurde der Frauentag 1911 in den USA, in der Schweiz, in Dänemark und Österreich veranstaltet. Bis zum Ersten Weltkrieg kamen Frankreich, Holland, Schweden, Russland und Böhmen hinzu.
Der Beginn des Ersten Weltkriegs vertiefte den Riss zwischen den Frauenbewegungen. Internationale Zusammenschlüsse waren kaum mehr möglich. Frauentage wurden von den Behörden verboten. Sozialistinnen kämpften – wenn auch überschattet von den Kriegsereignissen und teilweise beschäftigt mit kommunaler Fürsorge – weiter für das Frauenwahlrecht. Die bürgerliche Gertrud Bäumer (1873–1954) schuf aus patriotischer Motivation mit dem Ziel der „Aufrechterhaltung der Heimatfront“ den Nationalen Frauendienst. Viele SPD-Frauen schlossen sich der 1917 gegründeten Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) an, weil sie die Kriegspolitik der SPD-Führung nicht weiter mittragen konnten.
Gemeinsames Vorgehen von bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegungen
Das nahende Kriegsende, die politischen Unruhen und die revolutionäre Stimmung gaben der Frauenstimmrechtsbewegung neuen Aufschwung. Das bürgerliche Frauenstimmrechtslager vereinigte sich und begann mit der sozialdemokratischen Frauenbewegung zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wurden nun große Frauenversammlungen in vielen größeren Städten veranstaltet. Der ‚gemäßigte‘ Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung hielt sich allerdings bis zuletzt ganz fern. Die im Reichstag vertretenen Parteien verhielten sich weiterhin ablehnend. Am 22. März 1917 wurde der Gesetzentwurf für das allgemeine Wahlrecht „ohne Unterschied des Geschlechts“ durch Eduard Bernstein (SPD) und Genossen wieder vorgelegt und erneut abgelehnt.
Im Dezember 1917 bekam der Preußische Landtag eine Erklärung zur Wahlrechtsfrage überbracht. Sie war von Marie Juchacz für die Frauen in der MSPD, Marie Stritt für den Deutschen Reichsbund für Frauenstimmrecht und Minna Cauer (1841 – 1922) für den Deutschen Bund für Frauenstimmrecht unterschrieben. Entsprechende Gesetzentwürfe der SPD zur Durchsetzung des Frauenwahlrechts wurden noch bis Juli 1918 vom Reichstag abgelehnt. Auch die ‚gemeinsame Erklärung‘ machte keinen Eindruck.
Endlich das Frauenwahlrecht
Deutschland war mitten im politischen Umsturz, als die Frauenrechtlerinnen ihr lang gesetztes Ziel erreichten. Vom Matrosenaufstand Anfang November 1918 in Kiel ausgehend, bildeten sich zu Beginn der Revolution von 1918/19 in nahezu sämtlichen deutschen Städten revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte, die sich um die Versorgung kümmerten und die politische Macht übernahmen. Sie forderten Frieden, Demokratie und die Abdankung des Kaisers sowie der übrigen Herrscher in Deutschland. Nach der Erklärung des Thronverzichts durch den Reichskanzler am 9. November und der Flucht des Kaisers am 11. November 1918 brach der Obrigkeitsstaat zusammen. Obwohl viele Frauen bei den revolutionären Aktionen beteiligt waren, sind nur wenige in die Geschichte eingegangen. Unter ihnen Toni Sender (1888–1964) in Frankfurt, Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann in München, Anna Nemitz in Groß-Berlin (1873–1962), Clara Zetkin in Stuttgart. Auf dem Allgemeinen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte vom 16. bis 21.12.1918 in Berlin waren von 496 Delegierten zwei Frauen: Käthe Leu aus Danzig und Klara Noack aus Dresden. Die Frauenstimmrechtsforderung gehörte dennoch zu den Parolen der Arbeiter- und Soldatenräte.
Frauen in den Parlamenten
Zwischen 1918 und 1933 versuchte keine Partei mehr das Frauenwahlrecht anzutasten. Am 19. Januar 1919, zur Wahl der verfassunggebenden Nationalversammlung, durften Frauen erstmals bei einer landesweiten Wahl in Deutschland wählen und sich selbst zur Wahl stellen. Für die Linken stand die Wahl im Schatten der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht (1871–1919), vier Tage vor dem Wahltermin. Und freilich auch unter der Trauer um die zahllosen Toten und Verletzten des Ersten Weltkrieges. Die Wahlbeteiligung war mit 82,4 % der wahlberechtigten Männer und 82,3 % der Frauen hoch. Es kandidierten 300 Frauen. Insgesamt zogen 37 Frauen und 368 Männer in die Nationalversammlung ein. Vier Nachrückerinnen kamen später dazu. Das war ein Anteil von fast zehn Prozent der Abgeordneten. Am 14. August 1919 wurde die Weimarer Verfassung verkündet, in der das allgemeine Wahlrecht festgeschrieben war.
Von den 467 Parlamentsmitgliedern, die im Juni 1920 in den Deutschen Reichstag der Weimarer Republik einzogen, waren 37 (8,7 %) Frauen, vier Nachrückerinnen kamen hinzu. 22 dieser Parlamentarierinnen gehörten SPD und USPD an, die restlichen 15 verteilten sich auf die übrigen Parteien.
Die Sozialistinnen brachten frischen Wind und neue Themen in das Parlament, denn sie sorgten dafür, dass soziale Probleme der unteren Schichten, zu denen die meisten selbst gehört hatten, diskutiert wurden und in die Sozialgesetzgebungen eingingen.
Am 19. und 20. Februar 1919 sprachen Marie Juchacz für die MSPD und Luise Zietz für die USPD als erste Frauen vor einem deutschen Parlament. Mit der Anrede „Meine Herren und Damen“, lösten sie Heiterkeit aus. „Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf“, stellte Marie Juchacz fest. „Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit; sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“ Auch verwies sie darauf, dass die Gleichberechtigung in zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Beziehung noch lange nicht erreicht sei. Luise Zeitz kommentierte die ersten Vorlagen der Regierung und wurde immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen, während sie die Gemeinsamkeiten zwischen SPD- und USPD-Frauen hervorhob. Die Euphorie der Frauen dauerte nicht lange.
Clara Zetkin, die in der Zwischenzeit der KPD angehörte, war ebenfalls Reichstagsabgeordnete. Sie eröffnete am 30. August 1932 als Alterspräsidentin den Deutschen Reichstag. Es war der letzte große Auftritt der streitbaren Kommunistin. Von Krankheit schwer gezeichnet, beschwor sie noch einmal den revolutionären Kampf des Proletariats und nahm die Nazis ins Visier: "Das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um den Faschismus zurückzuwerfen." Sie wurde von zu wenigen gehört. 1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Sie schlossen Frauen, die für politische Ämter kandidieren wollten, aus.
Frauen wie Männer, die die Politik der Nazis nicht mitmachten, leisteten Widerstandsarbeit, waren Verfolgungen ausgesetzt oder kamen in Konzentrations- und Todeslagern um. Frauen wie Männer lebten im Exil und Frauen bauten mitunter auch dort Frauenorganisationen auf. Viele haben aber auch den inneren Rückzug angetreten, andere haben Anpassungsleistungen gebracht und wieder andere waren Täter*innen; Akteur*innen im schlimmen Sinne.
Der Kampf ist nicht zu Ende
Erst nach 1945 konnten Frauen wieder an die demokratische Entwicklung der Weimarer Republik anknüpfen. Diesmal waren nur vier Frauen im Parlamentarischen Rat.
Die ‚Frauenfrage‘ ging in der Bundesrepublik nur langsam voran. Darauf hinzuweisen, dass eine Demokratie unvollendet ist, solange die Ungleichheit zwischen verschiedenen Geschlechtern und Lebensformen fortbesteht, war und ist die Aufgabe von kritisch-feministischer und von der Politik von FLINTA*.
Im Zeichen des Rechtsrucks und der Wiederauflage konservativer Frauen*- und Geschlechterpolitik und heteronormativer Familienbilder sowie antifeministischer, rassistischer, antisemitischer, homophober und sexistischer Haltungen sind wir damit beschäftigt, dafür zu kämpfen, dass das Rad der Zeit durch konservative Kräfte nicht wieder zurückgedreht wird. Wir brauchen breite Bündnisse zur Organisierung von Protest und Widerstand. Vor allem fordern wir „Nieder mit den Waffen“ – überall. Wir streiten für den Frieden und für den Erhalt der Mit- und Umwelt – europaweit und weltweit.
01.04.2022
